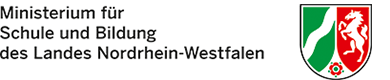-
4. Fragen zum Unterricht und zum berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst
Im Folgenden werden Fragen zum Einsatz in der Schule und zum berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst beantwortet.
4.1 Wie viele Stunden pro Woche sind zu unterrichten?
Die Unterrichtsverpflichtung auszubildender Lehrkräfte beträgt an einer Grundschule, an einer Hauptschule oder an einer Realschule bzw. Sekundarschule 28 Wochenstunden.
Die Unterrichtsverpflichtung auszubildender Lehrkräfte an einem Gymnasium, einer Gesamtschule, einer Sekundarschule, einer Gemeinschaftsschule (Schulversuch) oder einem Berufskolleg beträgt 25,5 Wochenstunden.
An Weiterbildungskollegs beträgt die Unterrichtsverpflichtung im Bildungsgang Abendgymnasium 22 Wochenstunden, im Bildungsgang Abendrealschule 25 Wochenstunden.
Für die Teilnahme an der Ausbildung durch das Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung erhalten die Lehrkräfte in Ausbildung an allen o.g. Schulformen während der gesamten Ausbildungszeit durchschnittlich sechs Anrechnungsstunden auf ihre Unterrichtsverpflichtung.
4.2 Kann das Arbeitsverhältnis auch in Teilzeitform absolviert werden?
Ja, aber die Unterrichts- und Ausbildungsverpflichtung darf insgesamt 20 Stunden nicht unterschreiten. Eine Reduzierung der Ausbildungsstunden am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung ist nicht möglich.
4.3 Wie lange dauert die Ausbildung?
Die Ausbildung umfasst in der Regel 24 Monate. Eine individuelle Verkürzung um 6 Monate ist im Einzelfall unter Anrechnung von Vordienstzeiten möglich. Eine einmalige Verlängerung um maximal 6 Monate kann bei nachgewiesenen Krankheitszeiten oder nach nicht bestandener Staatsprüfung erfolgen.
4.4 Wann ist die Ausbildung abgeschlossen?
Das Ziel des berufsbegleitenden Vorbereitungsdienstes ist die Befähigung, ein Lehramt an öffentlichen Schulen auszuüben. Somit ist die Ausbildung mit dem Erwerb einer Lehramtsbefähigung des Lehramtes, in dem die Bewerberin oder der Bewerber ausgebildet wird, abgeschlossen.
Die dafür erforderlichen Kompetenzen sind in der Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Zweiten Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen (OVP) in der Anlage 1 aufgeführt. Die Ausbildung endet, wenn die Staatsprüfung bestanden oder endgültig nicht bestanden wurde.
4.5 In welchen Fächern findet die Ausbildung statt?
Die Ausbildung findet in den beiden Fächern statt, für die die Seiteneinsteigerin oder der Seiteneinsteiger eingestellt worden ist und die im Rahmen der Einstellung festgelegt worden sind. Die Fächer der Ausbildung müssen in der Lehramtszugangsverordnung (LZV) für das jeweilige Lehramt aufgeführt sein und an der einstellenden Schule unterrichtet werden.
Unterricht in Fächern freiwilliger Arbeitsgemeinschaften, die keine Unterrichtsfächer in den Lehrplänen der jeweiligen Schulform sind, genügt den Anforderungen an einen berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst nicht. Für jedes Fach muss mindestens eine ausgebildete Lehrkraft bereits als Ausbildungslehrerin oder Ausbildungslehrer an der Schule unterrichten und bereit sein, die Aufgabe der Ausbildungsbegleitung im Unterricht unter Anleitung zu übernehmen.
Der Einsatz in weiteren Fächern soll während der Ausbildung vermieden werden.
4.6 Wer ist für die Ausbildung verantwortlich?
Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist für die Ausbildung an der Schule und die Leiterin oder der Leiter des Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung für Lehrämter an Schulen (ZfsL) für die Ausbildung im ZfsL verantwortlich. Die Gesamtverantwortung liegt bei der Leiterin oder dem Leiter des ZfsL.
4.7 Welche Aufgaben hat das Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung?
Das Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) entwickelt zusammen mit der Lehrkraft in Ausbildung einen standard- und kompetenzorientierten Ausbildungsplan bezogen auf die Handlungsfelder in der Schule.
Dazu findet innerhalb der ersten sechs Wochen des berufsbegleitenden Vorbereitungsdienstes ein Ausbildungsplanungsgespräch unter der Leitung des ZfsL statt, an dem Vertreterinnen oder Vertreter der schulischen Ausbildung mitwirken. Ausgangspunkt des Gesprächs ist eine von der Lehrkraft in Ausbildung in jedem Fach geplante und durchgeführte Unterrichtseinheit an der Ausbildungsschule. Das Gespräch dient einer ersten Bestandsaufnahme vorhandener schulpraktischer und fachbezogener Kompetenzen sowie der Vereinbarung eines individuellen Ausbildungsplans. Das Gesprächsergebnis wird von der Lehrkraft in Ausbildung doku-mentiert. Die Vereinbarungen werden während der Ausbildung kontinuierlich fortgeschrieben.
Der Aufbau erforderlicher fachwissenschaftlicher Kompetenzen erfolgt in der Eigenverantwortung der Lehrkraft in Ausbildung. Beratende Unterstützung dabei erhalten sie von allen Ausbilderinnen und Ausbildern.
Ausbilderinnen und Ausbilder des ZfsL führen wöchentliche Ausbildungsveranstaltungen durch. Sie besuchen die Lehrkraft in Ausbildung in ihrem Unterricht und begleiten sie fachlich beim Kompetenzaufbau in allen Handlungsfeldern. Sie unterstützen den Professionalisierungsprozess durch überfachliche Ausbildungsveranstaltungen, in denen die Lehrkräfte in Ausbildung gemeinsam lernen. Für die Fächer werden ebenfalls Ausbildungsveranstaltungen durchgeführt.

4.8 Welche Beratungsansprüche haben die Lehrkräfte in Ausbildung durch das Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL)?
Die Lehrkräfte in Ausbildung haben einen Anspruch auf mindestens 20 Beratungen (Besuche im Unterricht sowie weiteren Handlungsfeldern der Lehrkraft in Ausbildung und Beratungsgespräche im Anschluss an eingesehene Ausbildungsleistungen). Außerdem können sie am Unterricht von Ausbilderinnen und Ausbildern des ZfsL teilnehmen. Die Beratungen beziehen sich ausdrücklich auf alle Handlungsfelder der jeweiligen Schulform. Neben dem Unterrichten sind das beispielsweise Aufgaben der Lehrkräfte bei der Pausenaufsicht, bei Unterrichtsgängen oder Klassenfahrten, bei der individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern, in Konfliktsituationen, Elterngesprächen und Konferenzen. Lehrkräfte in Ausbildung werden durch die Ausbilderinnen und Ausbilder des ZfsL beraten, die ihre fachliche und überfachliche Ausbildung leiten.
4.9 Welche Ausbildungs- und Beratungsgespräche haben die Lehrkräfte in Ausbildung in ihrer Schule?
Sie haben Anspruch auf eine mindestens einstündige wöchentliche Beratung durch die Ausbilderinnen und Ausbilder der Schule in jedem der beiden Ausbildungsfächer.
Ihnen wird die Teilnahme am Unterricht von Ausbilderinnen und Ausbildern der Schule nach Absprache ermöglicht. Die Schule kann darüber hinaus weitere Beratungsangebote mit der Lehrkraft in Ausbildung vereinbaren.
4.10 Erhalten die Lehrkräfte in Ausbildung Auskünfte über den Ausbildungsstand?
Grundsätzlich ist der Ausbildungsstand Gegenstand bei allen Beratungsgesprächen.
Zusätzlich sind drei umfassende Planungsgespräche im Laufe der Ausbildung vorgesehen: Das erste Gespräch findet innerhalb der ersten sechs Wochen der Ausbildung und das zweite Gespräch vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres statt. Etwa sechs Wochen vor der Prüfung findet schließlich das dritte Gespräch statt.
4.11 Wann und in welcher Form erfolgt die Qualifizierung in Bildungswissenschaften?
Im ersten Ausbildungsabschnitt nehmen die Lehrkräfte in Ausbildung an einem 40-stündigen Kurs in Bildungswissenschaften unter Berücksichtigung ihrer Bezüge zu den Fächern der Ausbildung teil.
Der Kurs schließt mit einer Prüfung, bestehend aus einem Kolloquium von 60 Minuten Dauer, ab. In der Prüfung wird der schulpraktische Ausbildungsstand, insbesondere der in den Fächern, berücksichtigt.
Diese Prüfung kann bei Nichtbestehen innerhalb von drei Monaten einmal wiederholt werden. Das Bestehen der bildungswissenschaftlichen Prüfung ist Voraussetzung für die Fortsetzung der berufsbegleitenden Ausbildung und die Zulassung zur Staatsprüfung.
4.12 Wie sieht die Ausbildung im ersten Ausbildungsabschnitt aus?
Das erste Ausbildungshalbjahr ist gekennzeichnet durch eine Eingangsphase, in der fachliche, überfachliche und bildungswissenschaftliche Aspekte miteinander verbunden sind.
4.13 Wie sieht die Ausbildung in den weiteren Ausbildungshalbjahren aus?
Ab dem zweiten Ausbildungshalbjahr nehmen die Lehrkräfte in Ausbildung an den fachlichen und überfachlichen Ausbildungsveranstaltungen zusammen mit den Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern teil.
4.14 Welche Vorschriften gelten für die Staatsprüfung?
Die Staatsprüfung ist identisch mit der Prüfung von Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern am Ende des Vorbereitungsdienstes. Derzeit besteht sie aus:
- zwei schriftlichen Planungen für die beiden Unterrichtspraktischen Prüfungen,
- zwei Unterrichtspraktischen Prüfungen und
- einem Kolloquium.
© 2024 MSB.NRW